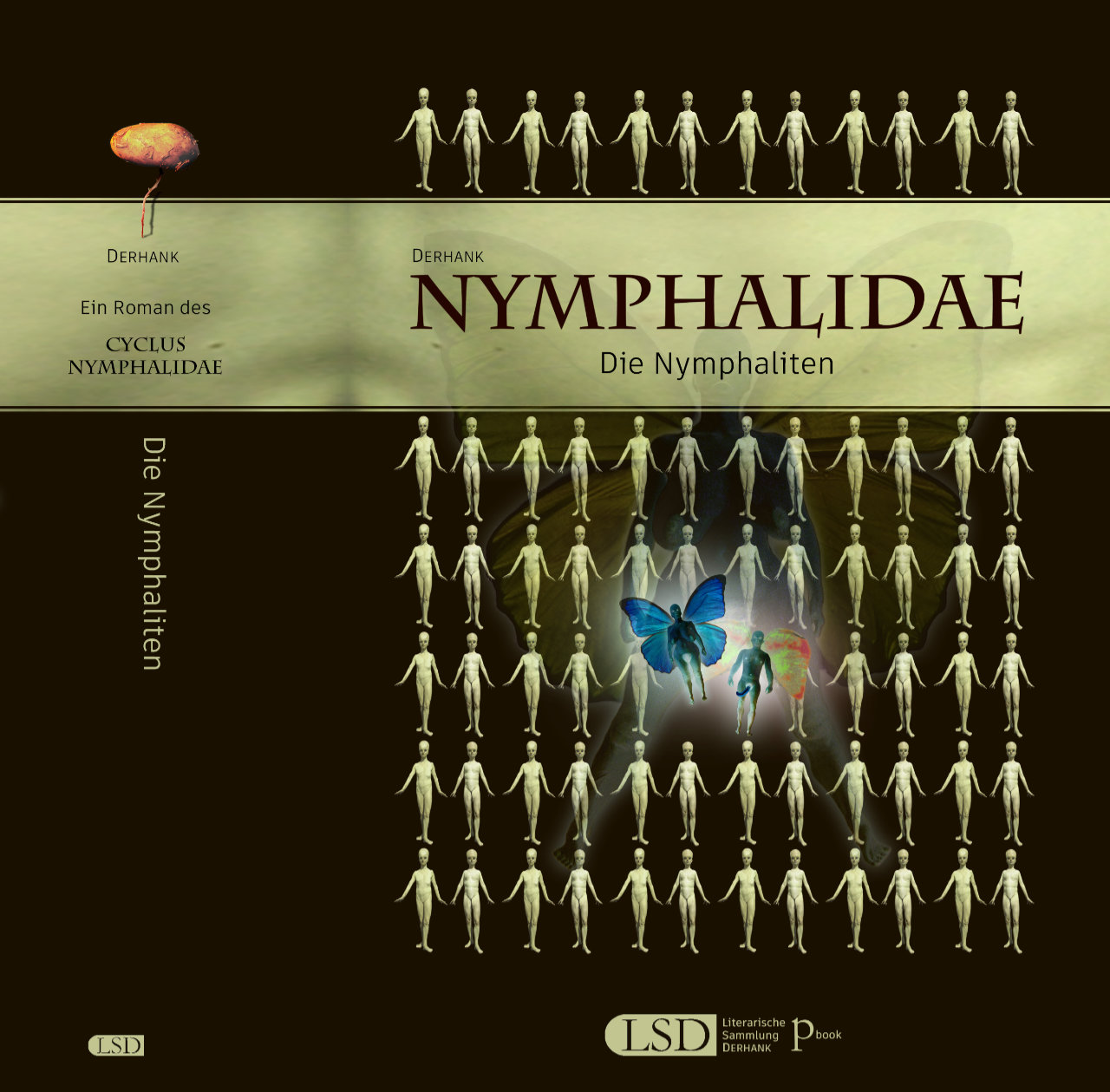
Die Nymphaliten – Leseprobe
Clara hatte den Fernseher eingeschaltet und sah eine schwebende Kartoffel, deren Wurzeln wie Tentakel über den Wolkenkratzern New Yorks hingen. Sie grinste ungläubig. Ein UFO? War das ein Spielfilm? Aber nein, es waren die gewünschten German News auf SBC News! Eben die deutschen Nachrichten, die sie immer wieder gerne sah, um ihr ohnehin gutes Deutsch aufzufrischen. Was sie aber dort sah und hörte, hatte nichts mit Deutschland oder mit deutscher Sprache zu tun. Dort schwebte ein »Ding« über Manhattan, fast so wie in dem Science-Fiction-Streifen »Independence Day«, den sie erst kürzlich mit Leon gesehen hatte. Und war nicht heute – bei den Yankees – Independence Day?
Die Stimme aus dem Off überschlug sich in einem nicht immer astreinen Aussie-Englisch, um den heimischen Fernsehzuschauern das zu beschreiben, was man ohnehin sah: ein riesiges – Raumschiff. So zumindest nannte es der australische Reporter. Er nannte es »Raumschiff«, obwohl es doch eher aussah wie ein im Sturz hängengebliebener Meteorit, ein unförmiges Gebilde aus Stein oder rotem Lehm, ein konturloser Klumpen. Der einzige Grund, es nicht »Meteorit« zu nennen, war der, dass es frei in der Luft schwebte. Er musste es also »Raumschiff« nennen – trotz seines irgendwie organischen Äußeren. Hätte ein Raumschiff – auch ein außerirdisches – nicht eigentlich aus Metall, Glas oder Kunststoff sein müssen? Dieses Ding aber war ein amorphes Irgendwas und wurde von wabernden Fetzen umweht, die es mehr schlecht als recht verhüllten. Es wirkte zudem wie lebendig, voller Kraft, drall, wie eine Wurzel, Knolle – eben wie eine Kartoffel! Wenn man die Lächerlichkeit dieses absurden Vergleichs ignorierte, dann sah dieses Ding tatsächlich aus wie eine saftige Frühlingskartoffel: mit feinen, sich leicht lösenden Häutchen, gewachsen in roter, südaustralischer Erde, ein gigantisches Exemplar, in die Luft geworfen und dort stecken geblieben. Als wäre nur die Zeit angehalten, als sähe sie ein Standbild im TV, so sehr erinnerte Clara dieses Gebilde an ihr Lieblingsgemüse, eingeklebt in den Postkartenhimmel über der Skyline von New York (ja, sie liebte Kartoffeln, und dank ihres deutschen Freundes längst nicht mehr nur in der angelsächsischen Fish-and-Chips-Version).
Unter dem Ding, unter den wunderschön changierenden kupfer-, rot- und ockerfarbenen Häuten, die wie Seide lose den Rumpf umwehten, hingen röhrenförmige Stängel oder Schläuche, entweder undefinierbare Instrumente oder tatsächlich die Wurzeltriebe der Riesenkartoffel – einige so lang, dass ihre Ausläufer die Stadt berührten. Die Wolkenkratzer wirkten wie aufgereihte Bauklötze, Spielfiguren, denen eine Kopffüßlerpuppe mit ihren Gliedern über die Gesichter streicht.
WAS war das?
Promotion für die Pommes-Frites-Industrie? Ein riesiger Werbeballon? Ein Zeppelin? Der Eindruck von einem ausgefallenen Gag zum Independence Day verstärkte sich noch mit dem Wechsel zu einer anderen Kamera: Man sah nun deutlich einen auf der erdfarbenen Oberseite aufliegenden Kranz, silbrig glänzend und sogar mit einem Bogen oder Ring versehen, an dem man dieses Objekt irgendwo hätte aufhängen können, wäre es nur nicht so gewaltig groß gewesen. Oder hing es etwa an diesem schnurgeraden Schweif, an dieser dünnen, geräuschlos flirrenden Linie, die das Gebilde mit dem Himmel verband?
Die amorphe Form machte es schwierig, die wirkliche Größe der Knolle einzuschätzen. Sie hätte genauso gut als verbeulte Christbaumkugel direkt vor der Kamera hängen können. Aber wenn das alles keine inszenierte Täuschung der Fernsehanstalten war, dann musste sie von überwältigender Größe sein – und tatsächlich wurde diese Information nun, nach fotometrischer Vermessung durch die Fachleute, von dem TV-Sprecher mit einhundertsechs Metern in der längsten Ausdehnung durchgegeben.
»Clara, Darling, bist du da?«, rief in diesem Moment ihr Mobiltelefon, das für Anrufe ihres Freundes auf Durchsprechen eingestellt war. Leon redete, ohne ihre Antwort abzuwarten, gleich weiter: »Clara, mach den Fernseher an, da ist was los in New York, irgend so ein Terroristending läuft da ab …«
[…]
Ein merkwürdiges Geräusch weckte Clara. Es dämmerte bereits. Sie richtete sich auf. Alles war still. Leon schlief, eingewickelt in seinen Schlafsack, mit dem Rücken zu ihr. Er atmete ruhig und gleichmäßig.
Sie kramte aus ihrem kleinen Rucksack ein weißes T-Shirt und eine frische Unterhose heraus und zog sich an. Ihre Shorts mussten noch vor dem Zelt liegen. Clara öffnete vorsichtig den Reißverschluss und steckte ihren Kopf durch den Schlitz.
Über ihr schwebte DAS DING! Eine Kartoffel. Riesig groß.
Sie stieß einen entsetzten Schrei aus und zog sich wieder zurück. Leon schreckte hoch.
»Was’s l’s?«, fragte er. Sie starrte mit aufgerissenen Augen in sein zerknittertes Gesicht. Er rieb sich die Augen.
»Das UFO!«, keuchte sie gegen den Widerstand ihrer vor Schreck gelähmten Brust.
»Du spinnst …«, murmelte er, nicht ganz überzeugend.
Jetzt erinnerte sie sich an das Geräusch, was sie geweckt hatte. Es hatte geklungen wie das Schnurren der Zugfeder der höhenverstellbaren Lampe über ihrem Küchentisch zu Hause. Und es war eigentlich auch nicht das Geräusch gewesen, was sie geweckt hatte. Es war die schlagartig eingetretene Stille. Die ganze Nacht hatte der monotone Gesang der Didgeridoos ihren Schlaf begleitet. Aber mit dem Schnurren war es still geworden.
Sie flüsterte: »Ich habe es gesehen! Es schwebt über uns.«
Er kroch auf allen vieren zum Zeltausgang und lugte nach draußen.
»Mein Gott …«
Sie drängte sich neben ihn und dann beobachteten beide die Landung eines außerirdischen Raumschiffs auf der Erde.
Es schwebte nicht genau über ihnen, sondern in vielleicht einhundert Metern Höhe über der höchsten Kuppe des Uluru, die jetzt, im zunehmenden Tageslicht, vom Zelt aus gut zu sehen war.
Das Ding senkte sich lautlos und langsam herab. Es leuchtete in den ersten Sonnenstrahlen wie eine gigantische orangerote Blume. Die losen Häute, Tücher oder was immer da um ihren Rumpf gewickelt war, wehten wie Gebetsfahnen in der leichten Brise.
Auf der Kuppe des Uluru, in etwa zweihundert Metern Entfernung, befanden sich vierzig bis fünfzig schwarze Australier, Angehörige ihres Volkes. Sie hatten ihr spirituelles Ritual unterbrochen und blickten wie erstarrt nach oben. Einige standen, einige saßen im Schneidersitz und andere lagen am Boden. Mehrere heruntergebrannte Feuer schwelten noch vor sich hin. Fast alle waren bemalt mit grauer Asche und weißen Linien, einige nackt, die meisten nur mit Shorts bekleidet. Da das UFO genau über ihnen schwebte und sich langsam auf sie herabsenkte, wurden sie schließlich unruhig. Offenbar war die Kuppe der auserwählte Landeplatz der Fremden.
Die Männer – es waren ausschließlich Männer – sprangen auf. Sie wichen ehrfürchtig oder ängstlich immer weiter auseinander und bildeten dadurch ungewollt einen Kreis um die voraussichtliche Landestelle. Dann sah Clara das gleiche Schauspiel wie gestern im TV: Aus dem Schiff heraus schob sich ein gelblich-weißer, dicker, fetter Tentakel nach unten. Sehr langsam, fast noch vorsichtiger als gestern tastete sich der ausgestreckte Arm des Schiffs an die Erdoberfläche heran.
Endlose Minuten verstrichen, in denen niemand sich rührte und alle nur wie gebannt die Annäherung dieses immer länger werdenden Rüssels beobachteten. Kurz bevor er den Uluru berührte, stoppte er. Der unterste Zipfel hing noch etwa dreißig oder vierzig Zentimeter in der Luft.
Nichts geschah.
Die Anangu blieben reglos stehen, unschlüssig, ob gleich »Die unheimliche Begegnung der dritten Art« oder aber »Mars Attacks!« Wirklichkeit werden würde.
Das Ding, der Schlauch, der Tentakel hatte tatsächlich sehr viel von einem Rüssel – und umso mehr, als es sich plötzlich erneut bewegte und sein unterstes Ende zu den Menschen aufrichtete. Sehr elastisch, ganz und gar unmetallisch, untechnisch, wie ein Elefant, dessen neugierige Nasenspitze in der Luft schnupperte, bog es sich in einem Neunzig-Grad-Bogen nach vorne und man konnte in einen offenen Schlund blicken.
Und darin stand eine menschenähnliche, hellhäutige Gestalt. Soweit Clara das auf die Entfernung ausmachen konnte, schien das Wesen nackt und kahlköpfig zu sein. Durch die Anangu ging ein Raunen, das man bis zum Zelt hören konnte.
»Wow!«, ächzte auch Leon. Er zwängte sich aus dem Zelt heraus, stand auf und ging ein paar Schritte in Richtung Landestelle. Clara rief ihm nach: »Bleib hier!«
Aber Leon beachtete sie nicht. Er starrte in seiner Nacktheit zu dem Außerirdischen, dem er in diesem Moment ähnlicher sah als Claras Stammesbrüdern. Schließlich überwand sie ihre Furcht, lief hinter ihm her und fasste ihn am Arm.
»Leon, bleib hier! Ich will da nicht hin!«
Das Wesen sprang aus der Luke und machte seine ersten Schritte auf dem Planeten Erde. Es ging dabei stark in die Knie und wirkte etwas wackelig. In dem Rüsselschlund erschienen weitere Gestalten. Wesen Nummer eins drehte sich zur Luke und nahm etwas entgegen, das an eine cineastische Strahlenkanone erinnerte. Sie war etwa einen Meter lang, bunt schillernd, mit einem gebogenen Handknauf und einer glänzenden Spitze. Die Anangu riefen durcheinander. Einige drehten sich um und rannten fort. Einer fiel in Ohnmacht. Sollte es doch die Mars-Attacks-Version sein, in der der erste Kontakt verlaufen würde? Clara erkannte Onkel Bart, der offenbar allen Mut zusammengenommen hatte und zwei Schritte mit offenen Armen auf das Wesen zutrat.
»Oh nein, Onkel!«, rief sie. Warum musste er den Helden spielen?
Das Wesen hatte sich wieder umgedreht und richtete die Waffe auf Bart. Der stoppte.
»Bart!«, kreischte Clara.
Es spannte seine Waffe durch. Und während Clara einen Knall oder Lichtblitz erwartete, der ihren Onkel zerstäubte, öffnete sich – ein Sonnenschirm. Er war zwar ungewöhnlich, dreieckig, zudem bunt wie ein Schmetterlingsflügel, aber so, wie das Wesen das Ding nun schräg gegen die noch tief stehende Sonne hielt, handelte es sich ganz offensichtlich um einen Schutz vor dem grellen Licht.
Clara spürte ihre weichen Knie und dann hörte sie das Lachen der Anangu; inbrünstiges Lachen der Erleichterung nach dem Todesschreck.
Leon sah Clara an und legte ihr einen Arm um die Schulter. Er grinste. Auch sie schüttelte mit einem leicht hysterisch klingenden Kichern den Kopf.
»Komm, wir sagen unseren Gästen ›Guten Tag‹!«
[…]
Zehn Tage blieb er bei Amphipyra. Der Kokon baumelte sanft an seinem silikonartigen Gummistrang. Der Aststumpf knarrte, und Leon war mehrmals an den Ausläufern der Sporenstränge hochgeklettert, um sich zu vergewissern, dass der Knoten hielt. Aber es gab keinen Grund zur Sorge. Das genetische Programm der Nymphaliten hatte auch dieses Detail geregelt. Der Knoten war Teil dieses Programms und hielt ebenso, wie der Kokon Sonne und Regen überstand.
Nur einmal noch war Leon im Lager gewesen. Er hatte neben ein paar wenigen Utensilien, Batterien und weiteren rohen Kartoffeln auch einen Stahltopf mitgebracht und kochte über einem kleinen Feuer, das er durchgehend am Leben hielt, die Erdäpfel. Nach und nach verbrauchte er die Lebensmittel, die er eingesteckt hatte. Er aß wenig.
Obwohl in der Nähe ein schmaler Bach verlief, wusch er sich nicht und sein Bart wurde struppig. Es geschah nichts und er tat nichts. Sein Körper war in zähen Kleister getränkt, der jede Aktivität so anstrengend machte, als wäre er nicht auf Nymph, sondern auf einem riesigen Gasplaneten gestrandet.
WAS, fragte er sich, hatte FÜR WAS noch einen Sinn? Er hatte Kartoffeln, die noch eine Weile hielten, er hatte ein Feuer, das die wilden Tiere fernhielt, und im Lager würde er trotz der Verwüstung so viel Vorräte und Ausrüstung finden, dass sein ganzes restliches Leben gesichert war. Allein die Nahrungskonserven waren für einhundert Menschen bemessen, um drei weitere Jahre zu überleben. Er würde es leichter haben als Robinson Crusoe. Das Strandgut der Zivilisation würde verhindern, dass er verwilderte und wie ein gehetztes Tier um sein Überleben kämpfen musste. Er war tatsächlich frei. Aber er blieb hier, verließ diese kleine Fläche zwischen Wurzeln und Stamm zehn Tage lang nicht. Seine Freiheit war die eines arbeitslosen, vereinsamten Sozialhilfeempfängers, der auf seiner Couch von Tütensuppe und dem stieren Blick in den Fernseher lebte.
Sein Fernseher hing einige Meter über ihm. Leon wollte es sehen, wenn Amphipyra als Tier herauskroch. Er blieb hier, weil es nur sie gab, weil seine versteinerte Freundin der einzige Bezugspunkt in den strukturlosen Koordinaten dieses immergrünen Planeten war.
Aber was sollte dann passieren? Amphipyra hatte ihn gewarnt – vor sich, vor ihrem eigenen Imago. Die Zeit des Friedens mit den Phaliten war vorbei. Er selbst hatte erlebt, wie Koehler von ihnen zerquetschte wurde. Er hatte die bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten Leichen gesehen. Der Planet Nymph hatte der Erde den Krieg erklärt. Die Menschen, die Terraner hatten zu verschwinden. Ob sie sich Cook oder Cortés nannten, sie alle würden wie Custer enden.
Was also wollte er wirklich? Hier bei Amphipyra? Den Tod?
Ja. Je näher der Zeitpunkt ihres Schlüpfens kam, desto mehr wünschte sich Leon den Tod. Er wollte diese leere Freiheit nicht. Er wollte diese Albträume nicht, die ihn in seinen Schlafphasen überfielen. Er wollte nicht Tag für Tag überleben, für nichts, für niemanden, bis irgendein Tag der letzte sein würde. Er wollte, dass Amphipyra ihn wieder in den Arm nahm, und sei es auch ein letztes Mal, nur um ihn zu vernichten. Er wollte in ihren Armen sterben, ausgehen wie eine Kerze, verrauchen, verlöschen. Das war der Grund, warum er noch hier war.
Leon hatte sich von den Zeiten des Planeten gelöst. Wann er aß, trank oder schlief, hatte nichts mit dem Stand der hiesigen Sonne zu tun. Er hatte seinen alten, terranischen Vierundzwanzig-Stunden-Rhythmus wiedergefunden und das Gefühl für die Zeit der Metamorphose verloren. Am zehnten Tag sollte Amphipyra, so schrieb es ihr genetisches Programm vor, wieder auferstehen. Doch als der Tag gekommen war, war Leon gerade eingeschlafen und wurde in seinem Traum von einer menschengroßen Hornisse bedrängt.
Das Ei machte ein Geräusch.
[…]